In diesem autobiografischen Essay geht Daniel Schreiber der Frage nach, was Zuhause ist. Mit Hilfe von Philosophie, Soziologie, Psychoanalyse und seiner eigenen Biografie identifiziert er Zuhause nicht als etwas Gegebenes, sondern als einen Ort der Sehnsucht, nach dem Menschen ein Leben lang suchen.
„Oft heißt es, dass man seiner Herkunft nicht entfliehen kann. Ich glaube, das stimmt. Nur bedeutet das nicht, wie viele Leute denken, dass man nicht ein anderes Leben führen kann als die eigenen Eltern und Großeltern. Es bedeutet, dass man die Erinnerungen und Erfahrungen aus der frühen Kindheit, die verschiedenen Ichs, die man einmal war, nie verlieren wird, dass sie in einem selbst immer aktiv sein werden, ob man es will oder nicht und ob es einem bewusst ist oder nicht. Es bedeutet, dass man sich diesen Facetten der eigenen Herkunft, des eigenen Ichs stellen muss, wenn man zufrieden sein möchte und die Möglichkeiten des Lebens, das man auf dieser Welt hat, ausschöpfen will. Wem also könnte ein Schwebezustand, wie jenes Gefühl des zuhauselosen Zuhauses einer war, wirklich jemals genügen? Geht es nicht darum, ein Leben zu führen, das mehr beinhaltet, als einsam durch die Welt zu gehen? Ein Leben, in dem man sich nicht verstecken oder weglaufen muss? Geht es nicht darum, einen Ort für sich zu finden, an dem man sich eine Zukunft vorstellen kann? Darum, die verschiedenen Fäden des eigenen Lebens zu verbinden? Sollte es nicht darum gehen, die Splitter seiner selbst, in die man über die Jahre zerbrochen ist, einzusammeln und zu etwas Neuem zusammenzufügen?
(Daniel Schreiber, Zuhause, S.93)
Suche nach Verwurzelung
Was der Autor sich fragt: Ist die Suche nach Verwurzelung oder wie es der indisch-amerikanische Ethnologe Arjun Appadurai geschrieben hat, der Wunsch nach Verortung wirklich ein menschliches Grundbedürfnis?
Und wenn ja, ist es tatsächlich der Geburtsort, der dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, Sicherheit und Gemeinschaft befriedigen kann? Nach der Wahrnehmung von Schreiber gibt es für viele darauf keine klare Antwort. Mal ist Zuhause mit den Eltern verbunden, mal mit der Wahlheimat, mal mit dem Arbeitsort oder dem Ort, an dem Partner oder Partnerin leben. Was er als Antwort notiert: Zuhause ist ein lebenslanger Suchprozess.
Daniel Schreiber hielt sich zu Beginn seines Essays in London auf. Dort ist er häufig mehrere Monate geblieben. Allerdings befand er sich in einer seelischen Krise. Die Beziehung zu seinem Partner war zu Ende gegangen, und er selbst wusste nicht so recht wohin mit sich. Die Suche nach Sicherheit und Zugehörigkeit in einer Zeit des inneren Aufruhrs und der Krise war ein Antrieb, den vorliegenden Essay zu schreiben.
Eine wichtige Erkenntnis bei der Beschäftigung mit dem Thema kam ihm schnell:
„Vor allem diejenigen, die den Normen der Welt, in die sie hineingeboren wurden, nicht entsprechen, die mit ihrem Herkunftsort Erfahrungen von Ausgrenzungen und Stigmatisierung verbinden, können anderswo Menschen finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie sie selbst, oder auch schlicht Menschen, die sie so akzeptieren und lieben, wie sie sind.“ (S. 13)
Da, wo Menschen sich Raum für ihr Anderssein geben, dort fühlt man sich sicher und zugehörig. Zuhause ist also nach Schreiber nicht unbedingt mit einem konkreten Ort verbunden, sondern vielmehr ein Sehnsuchtsort, der die Möglichkeit bietet, bei sich selbst anzukommen. Das waren wichtige Sätze für den Autor, der mit einer Depression kämpfte. Um Antworten auf die Frage zu bekommen, warum er sich so dringlich nach Sicherheit und Zugehörigkeit sehnte, begann er, sein bisheriges Leben zu rekapitulieren.
Kindheitsmuster
Als Überschrift für seine Suchbewegungen bezog er sich auf William Faulkner. Der hatte geschrieben, dass das Vergangene niemals tot sei. Es sei noch nicht einmal vergangen. Das Vergangene lebt also in Menschen fort. Sie wiederholen Kindheitsmuster, Wertevorstellungen, Familienerzählungen oder das nicht Erzählte, die Leerstellen, die zumeist unbewusst wahrgenommen aber nicht aufgelöst werden. All diese Denkmuster und Deutungsfiguren beeinflussen Menschen und prägen aktuelle Verhaltensweisen mal bewusster, mal unterbewusster mit.
Daniel Schreiber bekam von seinen Eltern eine Art Familienarchiv in die Hand gedrückt, als er aus London zurückkehrte. Es war eine unsortierte Sammlung von Geburts- und Sterbeurkunden, Trauscheinen, Briefen und Magazinen aus den dreißiger Jahren, das sein Vater von seiner älteren Schwester bekommen hatte. Der gab es nun dem Sohn weiter mit dem Kommentar, dass es sich schließlich auch um seine Vergangenheit handelte.
Schnell fand Schreiber die Geschichte seiner Urgroßmutter, die aus der Stadt Wolhynien im russischen Kaiserreich des 19. Jahrhunderts kam. Die Menschen lebten dort von der Landwirtschaft. Zar Alexander II. hatte Mitte des 19. Jahrhunderts darum geworben, dass Zuwanderer aus den Nachbarländern kamen, um als Bauern, Förster und Landarbeiter im russischen Kaiserreich zu arbeiten. Ihnen wurde preiswerter Grund und Boden und Religionsfreiheit versprochen. Das war für Familien aus Tschechien, der Ukraine, aus Weißrussland, Polen und Litauen, Deutschland und vielen anderen Ländern verlockend. Sie lebten jahrzehntelang in multiethnischen und multireligiösen Zusammenhängen friedlich nebeneinander. Seine Urgroßmutter wurde 1906 geboren. Dreimal musste sich ihre Familie zu ihren Lebzeiten auf die Flucht begeben. Ein kleines Dorf in Brandenburg wurde zu ihrer letzten Bleibe. Dort fühlte sie sich aber bis zu ihrem Tod als Fremde in einem fremden Land.
Zuhause als mythisch aufgeladener Ort
Ihr Herkunftsort wurde zu einem mythisch aufgeladenen Ort, den es nicht mehr gab. Zugleich schwieg sie über ihre Erlebnisse in zwei Kriegen. Sie schwieg zu ihren Erlebnissen bei Vertreibung und auf der Flucht. Die Familie wusste lange Zeit gar nicht, woher die Urgroßmutter gekommen war. Der Name Wolhynien war in der Familie unbekannt. Das Schweigen der Urgroßmutter und die fehlenden Nachfragen hatten eine Art kollektives Vergessen bewirkt.
Daniel Schreiber versuchte in seinem Buch, die Geschichte der Urgroßmutter und danach der Großeltern zu rekonstruieren. Er stieß aber immer wieder auf Leerstellen und Schweigen hinsichtlich der Geschehnisse während der Nazidiktatur. Niemand hatte in der Familie über Krieg, Flucht und Vertreibung gesprochen. Dabei war die Familie über Ostpreußen, Schlesien und Polen mit vielen dramatischen Irrungen und Wirrungen nach Brandenburg geflohen. Die Erfahrungen wurden aber nicht überliefert. Die psychischen und körperlichen Belastungen lassen sich vom Urgroßenkel nur erahnen.
Deutschland war bereits zur Zeit der Geburt der Urgroßmutter keine monolithische Nation, sondern ein vielfältiges Gemisch aus verschiedenen Milieus, Herkünften, Dialekten, Schichten, Kulturen, Weltanschauungen, religiösen und politischen Überzeugungen. Und die Flüchtlingswelle nach dem Zweiten Weltkrieg war die größte des 20. Jahrhunderts. Ein fünftel der damaligen Bevölkerung Deutschlands war auf der Flucht. Flucht, Vertreibung und Migration waren während und nach dem Krieg eher der Normalfall. Seine Familie machte da keine Ausnahme.
Allerdings gab es kein kollektives Bild von dieser Flucht, das sich ins Bewusstsein der nachkommenden Generationen eingeprägt hätte oder Teil einer Erinnerungskultur geworden wäre. Die Schuld und die Scham angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus haben die Menschen verstummen lassen. Ohne die Möglichkeit der Verarbeitung durch Erzählungen hatte sich seine Urgroßmutter in diesen Wirren ein idealisiertes Bild ihres früheren Zuhauses geschaffen. Sie brauchte es, um zu überleben, um seelisch zu verkraften, dass sie kein Zuhause mehr hatte und auch keins mehr fand. Alles, was Zuhause und Heimat einmal für sie war, befand sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Auflösung. Zuhause wurde verschoben in ein komplexes Gemisch aus Sehnsüchten, Stimmungen und Heimwehgefühlen.
Gleichzeitig waren die Begriffe von Zuhause und Heimat komplett von der völkisch-ideologischen Aufladung der Nationalsozialisten und der „Edelweiß-Purifizierung“ (S. 33) der Heimatfilme der fünfziger Jahre besetzt worden. Sie wurden nach dem Krieg zu Knotenpunkten der Nostalgie und der weichgewaschenen Erinnerungen. Unzählige Familiengeschichten wurden davon geprägt. Konkrete Erinnerungen wurden dagegen lange Zeit verschwiegen.
Posttraumatische Erfahrungen aus der Kriegszeit, Erlebnisse von Flucht und Vertreibung wurden allerdings nach Erkenntnissen von Psychoanalyse und Trauma-Forschung auch ohne Worte und Erzählungen in die nächsten Generationen hinein übertragen, sodass sie nicht nur die Erlebniswelt der Vorfahren, sondern auch die eigene genetisch und neurologisch formten.
Ruhelosigkeit
Von dieser Erkenntnis angestachelt, zog der Autor Linien von der Rastlosigkeit seiner Urgroßmutter hin zu seiner eigenen Ruhe- und Heimatlosigkeit. Er verband die Geschichten von Flucht, Sich-Niederlassen und von der Suche nach Zugehörigkeit mit seiner eigenen Lebensgeschichte. Denn keine Lebensgeschichte kommt aus dem Nirgendwo.
Schreiber notierte, dass die englischen Begriffe von „longing“, Sehnsucht, und „belonging“, Zugehörigkeit, nicht zufällig miteinander verwandt sind. Sehnsüchte seien oft rückwärtsgewandt und für viele mit Erinnerungen an die Welt der Kindheit verbunden. Von dieser Erkenntnis ausgehend fragte sich der Autor schließlich, welche Bedeutung seine Herkunft in seinem Leben hatte und hat.
Seine Antwort: Die Erfahrungen mit seiner Herkunft waren ambivalent. Er litt schon als Vierjähriger unter Ausgrenzung, war oft hin- und hergerissen und wollte fliehen. Das ‚heimhafte‘ und das ‚weghafte‘ tobten in ihm. Er wurde zum zeitgenössischen Nomaden, weil er sich zuhause nicht wohlfühlte. Aber das Nomadenhafte hatte seinen Preis. Traurigkeit, Orientierungslosigkeit, Fremdheit und Schmerzen prägten seine Wege. Was er schon früh verstand:
„Das Zuhause ist kein Paradies, aus dem wir vertrieben wurden. Dieses Paradies hat nie existiert.“ (S. 57)
Ausgrenzung und Mobbing
Für ihn war eine zentrale Lebenserfahrung, dass er schon früh wusste, dass er schwul war. Er wuchs in Mecklenburg auf. Als er Anfang der achtziger Jahre in den Kindergarten kam, stand Homosexualität in der DDR genau wie in der BRD noch unter Strafe. Schwule Männer galten als krank, pervers, potenzielle Straftäter, Kriminelle und Sexualstraftäter.
Er fühlte sich fremd und anders als die anderen. Seine Eltern reagierten eigentlich offen. Aber sie waren von der Situation dennoch überfordert. Denn befremdliche Identitäten wurden in Familien zumeist als Fehler in der Erziehung angesehen, was zumeist auch die Eltern in eine Identitätskrise stürzte. Schuld und Scham überschatteten alles. Die Verletzlichkeit des Kindes war nur schwer auszuhalten. Anpassungsversuche scheiterten. Selbsttäuschungen, Doppelleben und Lügen wurden los getreten, um es den anderen recht zu machen, nur um auch daraus wieder auszubrechen, weil er es nicht aushielt (S. 65).
Der soziale Druck eines kleinen Dorfes mit allem Klatsch, Gruppendruck, sozialer Kontrolle, Alkoholismus und aufgestauter individueller Frustration taten ein Übriges, dass er sozial geächtet wurde. Den Autor hatte es schon als Vierjährigen erwischt, da er angeblich feminin aussah und sich anders verhielt als die anderen. Die Angst aufzufallen und nicht so zu sein wie die anderen, war in den sowieso engen Freiräumen der DDR krass ausgeprägt. Der Autor erlebte sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule Ausgrenzung, Mobbing und psychische Gewalt, weil er anders war. Linientreue Erzieher und Lehrerinnen drangsalierten und terrorisierten ihn. Seinen Eltern erzählte er von alldem nichts. Er hatte nur Glück, dass seine älteren Geschwister und seine Eltern loyal waren, und dass die DDR 1990 Geschichte wurde.
Schreiber resümmierte: Er konnte sich in seiner Herkunftsfamilie nicht heimisch fühlen. Er konnte sich auch nicht mit den vorher gegangenen Generationen seiner Familie verbinden. Denn er passte nicht in die familiäre Abfolge von vorgegebenen Rollenzuweisungen. Er war auf der Suche nach Gleichgesinnten, mit denen er sich quer zum familiären Stammbaum horizontal verbinden konnte (S. 64). Er verlor darüber sein Zuhause, und es machte ihn einsam.
Rastlos und Heimatlos
Als er zehn Jahre später schließlich in New York studierte und lebte, nahm er Drogen, hatte verschiedene Sexpartner und stürzte sich in stoffliche und emotionale Abhängigkeiten. Sein inneres Ich war immer noch mit den Minderwertigkeitsgefühlen seiner Kindheit und Jugend beschäftigt. Es führte zu auto-aggressiven Verhaltensweisen.
„Wenn einem beigebracht wird, dass mit jemandem wie einem selbst etwas nicht stimmt, dass man grundlegend falsch und nicht akzeptierbar ist, lernt man letztlich, sich dafür zu schämen, wie man ist, man lernt, sich zu verstecken. Man wird zwar auch lernen, viel zu erreichen, auf Erfolgserlebnisse hinzuarbeiten, die eine gewisse Linderung verschaffen, man wird lernen, unter allen Umständen unangreifbare Fassaden aufzubauen und den äußeren Schein zu wahren. Vor allem aber lernt man, das, was einen im Kern ausmacht, zu hassen.“ (S. 75 f.)
Daraus ergab sich für Schreiber ein fundamentales Gefühl der Zuhauselosigkeit und der emotionalen Beschädigung. Selbsthass und Scham wurden seine treuesten Begleiter.
Das zuhauselose Zuhause
„Die schmerzhafte Sehnsucht nach einem Zuhause lebt in jedem von uns. Es ist die Sehnsucht nach dem Ort (…), an dem wir nicht in Frage gestellt werden.“ (Maya Angelou)
Diese zwei Sätze von Maya Angelou wurden für Schreiber wichtig. Er fühlte sich in New York zuhause. Dort hatte er sechs Jahre lang mit seinem Partner in Brooklyn gelebt. Dort fühlte er sich akzeptiert und geliebt. Dort war er zumindest momenthaft zuhauselos zuhause, wie er sich niemals in Deutschland zuhause gefühlt hatte.
Für ihn war es zudem erleichternd, seine Muttersprache für eine Zeit komplett in den Hintergrund zu verdrängen. Denn Deutsch war für ihn die Sprache der Verletzung und der Ausgrenzung. Englisch wurde für ihn die Sprache der Befreiung. In Englisch begann er auch eine Psychoanalyse. Die hätte er auf Deutsch nicht beginnen können. Somit wurde New York für ihn zu einem Depot von neuen Gefühlen und Erinnerungen. Er fühlte sich dort sicher, von seinem Freund geliebt, von den Menschen der Stadt geachtet. Die englische Sprache wurde zu einer Sprache von Respekt. Die deutsche Sprache stand für ihn für Missachtung. Aber in New York lebte gleichzeitig auch die Spirale der Selbstzerstörung in ihm weiter. Er trank zu viel, nahm Drogen, hatte auto-aggressive Anwandlungen und kämpfte mit Depressionen. Er blieb zuhauselos zuhause. Die Sicherheit war brüchig und trügerisch, aber sie verschaffte ihm eine Ruhepause.
Zu sich kommen
Zurück in Berlin hat er aufgehört zu trinken. Er blieb weiterhin auf der Suche nach sich selbst und nach einem inneren Ruhepunkt. Rastlos ging er durch die Stadt, die er hätte auswendig kennen sollen. Im Gehen, Wahrnehmen und Flanieren hat er sich schließlich wie ein Ethnograf mit neuem Blick an die Stadt herangemacht, die sein Zuhause sein sollte. Und im Gehen ist er ruhiger geworden. Auf der Suche nach einem Zuhause ist er schließlich bei sich selbst angekommen. Seine Suche hatte sich verschoben. Er hat nicht mehr nach einem Zuhause gesucht, sondern begonnen irgendwo zu wohnen und da zu sein. Das Wohnen wurde zum Anker in seinem Leben, während er erkannte, dass Heimat und Beheimatung ständig provisorisch und im Fluss bleiben würden. Er beschäftigte sich von da an mit dem Wohnen als seelischen Innenraum, in dem er Schutz und Ruhe finden konnte. Er bewegte sich zwischen innen und außen, zwischen Isolation und Teilhabe, zwischen Ich und Gesellschaft und akzeptierte, dass diese Phänomene auch beim Wohnen im Fluss bleiben würden. Er behauptete sich selbst, spürte sogar Anflüge von Zufriedenheit und richtete sich in aller Vorläufigkeit ein.
„Die amerikanische Intellektuelle Maggie Nelson beschreibt in ihrem Buch The Argonauts, dass sich das Sich-Einrichten in der Häuslichkeit für Schwule, Lesben, Transgender und alle anderen sich als queer identifizierenden Menschen in vieler Hinsicht problematischer ist als für die Mehrzahl der heterosexuell lebenden Menschen. Nelson schildert, wie sie, ihr Transgender-Partner Harry – ihre einzige Freundin, Lebenspartnerin und große Liebe – und ihre beiden Kinder sich zusammen ein Zuhause errichteten und wie schwierig dieser Prozess war. Ihnen sei es oft so vorgekommen, als würden sie eine Art Pionierarbeit leisten, so Nelson, als gäbe es keinerlei Vorbilder für die Art von Häuslichkeit, die sie und ihre unkonventionelle Familie benötigten – mehr noch, als wäre so etwas gesellschaftlich schlicht nicht vorgesehen. (…) Sie selbst, so Nelson, habe lange versucht, das Häusliche als einen in diesem Sinne politischen Protestraum zu verstehen, als eine Form queerer und feministischer Selbstbehauptung.“ (S. 117 f.)
Narben bleiben
Schreiber beendete seinen Essay, indem er dankbar darüberschreibt, dass er gelassener und ruhiger geworden ist. Er sucht nicht mehr nach dem einen Ort, an dem er sich zuhause fühlt. Stattdessen versteht er es nun als einen lebenslangen Prozess, Wurzeln zu schlagen. Das perfekte Zuhause gebe es sowieso nicht. Es sei eine Idealvorstellung, der man ein Leben lang hinterherrennen könne, oder man akzeptiert, dass es diesen Ort nicht gibt. Denn Beschränkungen, Enttäuschungen, Leerstellen und Narben gehörten genauso zum Leben dazu, wie glückliche Augenblicke, Momente von Zugehörigkeit und Zufriedenheit. Die gelte es bewusst wahrzunehmen und zu genießen.
Insofern bedeutet für ihn zuhause sein vor allem, bei sich selbst anzukommen und mit den disparaten Fäden, Strängen, Fragmenten und Bruchsteinen der eigenen Lebensgeschichte Frieden zu schließen. Dann sei es möglich daraus eine Lebenserzählung zu formulieren, die einerseits eine autobiografische Imagination bleibt und andererseits die Narben nicht verdecken muss. Sie ist, was es ist, eine fragmentarische Konstruktion, in der man sich momenthaft zuhause fühlen kann.
Zum Weiterlesen
Daniel Schreiber, Zuhause. Die Suche nach dem Ort, an dem wir leben wollen, Suhrkamp Taschenbuchverlag, Berlin 2018, 1. Aufl.
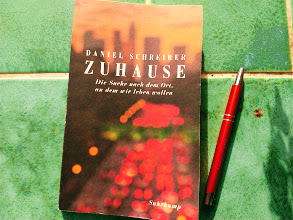



Trackbacks/Pingbacks